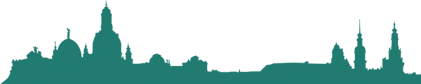|
 |
|
Zumal wenn gleichzeitig die bisher Allmächtigen innerlich zerrissen sind, von Selbstzweifeln übermannt werden und ihre Verbündeten und Parteigänger sie verlassen. Gelingt jenen, die den Wandel wollen, in einem günstigen Moment der erste entscheidende Schritt zum Sieg, dann breitet sich wie ein Feuer jenes rauschhafte Gefühl des so lange ersehnten Frühlings ein, das der englische Romantiker William Wordsworth im Rückblick |
| |
| auf das revolutionäre Paris von 1789 noch als alternder Reaktionär in die Worte fasste: „Bliss was it in that dawn to be alive“ – Glückselig war, wer diese Morgenröte erlebte. Wer an die hoffnungsvolle Zeit des revolutionären Wandels im Jahre 1989 vom 9. Oktober in Leipzig bis zum 9. November in Berlin zurückdenkt, wird sich erinnern, Ähnliches empfunden zu haben: Dieses viele Menschen verbindende Gefühl einer großen umfassenden Bewegung nach vorn, aber auch die unbestimmte Weite der vielen Erwartungen, wohin diese Entwicklung führen sollte. |
| |
| Zwei Erfahrungen sind es, welche die Revolution von 1989 in der DDR mit anderen Revolutionen gemein hat: Dass viele etwas Neues wollten, aber dass dieser gemeinsame Wille kein einheitlicher Wille war. Und dass von vielen das erhoffte Neue mit Erwartungen verbunden wurde, welche die Realität nicht vorsah. Woraus sich die dritte Gemeinsamkeit der Revolution in der DDR mit anderen Revolutionen ergibt, nämlich die der unvermeidlichen Enttäuschung über die neue Realität. Denn was die Menschen zur Revolution bewegte, war eben meist nicht ein realistisch durchdachtes und rational kalkuliertes Zukunftsprogramm, sondern der große Traum, den die Menschen schon immer träumten, wenn sie eine Chance sahen, die Widrigkeiten ihrer Lebensumstände zu überwinden. Der Dramatiker Peter Weiss lässt in seinem Stück „Die Verfolgung und Ermordung Jean Paul Marats“ den Marquis de Sade als zynischen Revolutionsnutzer und Revolutionsverächter sagen: |
| |
„So kommen sie zur Revolution
und glauben die Revolution gebe ihnen alles
Einen Fisch / einen Schuh / ein Gedicht /
einen neuen Mann / eine neue Frau
und sie stürmen alle Befestigungen
und dann stehen sie da
und alles ist wies früher war.“ |
| |
| Dieses Urteil ist zwar – objektiv gesehen – immer falsch. Denn jede Revolution schafft eine neue Wirklichkeit. Aber dass auf jede Revolution auch Ernüchterung, Enttäuschung und Resignation folgen, das ist ein geschichtliches Grundmuster. |
| |
| Was waren die Hoffnungen und Erwartungen, welche 1989 zur inneren Dynamik der revolutionären Entwicklung in der DDR wurden. Sehr vereinfacht kann man zwei große Strömungen unterscheiden, welche die gesellschaftliche Situation gegen den Willen der Machthabenden immer stärker bestimmten. Das waren einerseits Gruppen und Initiativen von Menschen, welche den Mut hatten, die Zustände in der DDR öffentlich zu kritisieren und auf Reformen im Land zu drängen. Dass sich diese meist auf die Ideale des Sozialismus beriefen und diesem ein menschliches Antlitz geben wollten, folgte aus ihren inneren Überzeugungen, entsprach aber auch den realen Machtverhältnissen. Was nicht wenige im Rückblick nicht oder nicht mehr verstehen, ist die Tatsache, dass eine Argumentation für Wandel und Erneuerung, die sich auf die ideellen Ursprünge des Sozialismus berief, zugleich vernichtend eben jene Gesellschaftsordnung kritisierte, ja, entlarvte, welche sich in der Honeckerzeit real existierender Sozialismus nannte. Denn damit bestritten Kritik und Dissens zugleich sehr wirkungsvoll die geschichtliche Legitimation der Herrschenden und beförderten interne Auseinandersetzungen bei deren Unterstützern. Die bleibende geschichtliche Leistung der Reform- und Bürgerrechtsgruppen besteht darin, geschichtliche Veränderung für eine wachsende Zahl von Menschen wieder denkbar und mithin ein solches Handeln wieder möglich gemacht zu haben. Und das zu einer Zeit, als sich auch viele im Westen Frieden nur auf der Basis des Status quo vorstellen konnten. Darum war ja auch im Westen für die meisten die deutsche Einheit kein politisches Ziel mehr. Nun war es die von diesen Gruppen in der DDR aktiv beförderte Dynamik der Geschichte, welche die deutsche Einheit wieder auf die Tagesordnung setzen sollte, auch wenn das viele von ihnen nicht beabsichtigten. Aber in dem sie für sich die Freiheit des Denkens und Handelns einforderten und diese selbst praktizierten, trugen sie maßgeblich dazu bei, dass Freiheit durch die Demonstranten wieder zur Realität wurde. Und in der realen Freiheit stellte sich die Frage nach der deutschen Einheit ganz von selbst – trotz aller dagegen gesetzter Ideologie in Ost und West. |
| |
| Die andere Tendenz, welche vor allem in den achtziger Jahren immer stärker hervortrat, war das immer häufigere Begehren, die DDR zu verlassen. Dafür gab es gewiss sehr unterschiedliche Gründe, aber in jedem Fall war es eine Entscheidung gegen den Sozialismus. Die Mauer war gebaut worden, um den Weg nach dem Westen abzuschneiden, was ja auch zunächst weithin gelang. Aber alles in der Welt hat seinen Preis. Der Preis der DDR dafür, international dennoch dazu gehören zu wollen, war Helsinki und der dort zähneknirschend von ihr zugestandene „Dritte Korb“, also Zugeständnisse auf dem Gebiet der Menschenrechte. Nun gab es zumindest einen Ansatzpunkt dafür, die Ausreise aus der DDR zu beantragen. Und obwohl die DDR versuchte, dies durch eine Fülle von Schikanen und groben Ungesetzlichkeiten zu stoppen, stieg die Zahl der Ausreiseanträge doch immer weiter. Der Versuch der SED-Führung, das Problem dadurch zu lösen, dass man einige der Hartnäckigsten ziehen ließ, konnte nicht gelingen. Denn Menschen sind gewohnt, ihre Chancen zu kalkulieren. Und da gilt in solchen Fällen nun einmal die Erfahrungswahrheit: Jeder Erfolg erhöht die Aussicht auf weiteren Erfolg. Und jede größere Aussicht auf Erfolg erhöht die Zahl jener, welche einen solchen Erfolg auch für sich versuchen. Dass die DDR auf diese Weise verändert würde oder zur Aufgabe gezwungen werden könnte, das glaubte damals wohl niemand. Empfindlich geschwächt und politisch weiter diskreditiert wurde sie durch die Ausreisebewegung allemal. Ja, es könnte sogar sein, dass dadurch jene, welche auf ernsthafte Veränderungen in der DDR drängten, etwas mehr Bewegungsraum erhielten, weil die Verunsicherung der Herrschenden ständig zunahm und diese erkennbar zwischen Überreaktion auf eine angebliche Welt voller Klassenfeinde und Hinnahme des sich faktisch Ereignenden ständig hin- und herschwankten. Man denke nur an die Basisaktionen zur Kontrolle der sogenannten Kommunalwahlen im Mai 89, gegenüber denen die SED weithin erst einmal hilflos war, um dann durch nassforsches Bestreiten der ja ohnehin fast jedem bekannten Wahrheit deren entlarvende und delegitimierende Wirkung noch zu verstärken. |
| |
| Zum revolutionären Wandel in der DDR kam es, als sich Ende September / Anfang Oktober die beiden Strömungen in der Bevölkerung zum gemeinsamen und immer stärker werdenden Protest vereinten. Dafür stehen die dramatischen Ereignisse in Dresden, als die Züge mit den Ausreisewilligen aus Prag in die Bundesrepublik wegen eines absurden Statusdenken der SED-Führung durch die DDR fahren mussten, dafür steht der Weg von der Forderung „Wir wollen raus“ zur Drohung „Wir bleiben hier“ bei den Demonstrationen in Leipzig, dafür steht insbesondere jene machtvolle Demonstration am 9. Oktober in Leipzig, als Zehntausende mit ihrem Ruf „Wir sind das Volk“ erfolgreich eben jene Macht für sich beanspruchten, welche die SED-Führung jahrzehntelang usurpiert hatte. Der 9. Oktober in Leipzig als Höhepunkt der Aktionen und Demonstrationen in jenen September- und Oktobertagen – das ist der Sieg der Revolution in der DDR, das ist der Tag der Freiheit, auf den der Mauerfall am 9. November als zwingende Konsequenz folgte. An diese geschichtliche Wahrheit müssen wir immer wieder erinnern, gerade jetzt, da von westlichen Historikern und Publizisten im 20. Jahr des Mauerfalls einmal wieder der Versuch gemacht wird, die Bedeutung der revolutionären Entwicklung in der DDR zu leugnen oder herunter zu spielen. Da will man nur ein Implodieren der DDR sehen oder behauptet allen Ernstes, die Maueröffnung sei ein Werk der westlichen Medien gewesen. |
| |
| Nein, hätten sich die Menschen in der DDR nicht bewegt, dann hätte sich auch die Geschichte nicht bewegt. Sie haben sich mit dem 9. Oktober 1989 und in den Wochen danach die Bürgerrechte der freien Rede, der Demonstration und der Selbstorganisation genommen. Und angesichts der millionenfachen Forderung nach Reisefreiheit war auch die Mauer so oder so nicht mehr zu halten. Da sind die konkreten Umständen, unter denen es zur Maueröffnung kam, zweitrangig. Bedeutsam ist dagegen, dass es wiederum die Menschen in der DDR waren, welche vor den Politikern in West und Ost das Thema der deutschen Einheit auf die Tagesordnung setzten. Freilich stimmten nicht alle in den Ruf „Wir sind ein Volk“ ein, aber es war doch unübersehbar die Mehrheit. Dass nicht wenige von jenen, welche sich bereits mutig engagiert hatten, als die übergroße Mehrheit noch abwartete, für eine eigene Entwicklung der DDR waren, bleibt gleichwohl wahr. So weit gesteckt und konkret schwer zu fassen auch die Träume waren, welche die Menschen zum eigenständigen und selbstbewussten Handeln ermutigt hatten, so lassen sich darin dennoch wiederum zwei Visionen unterscheiden – der Traum von einem menschenwürdigen Sozialismus und der Traum vom guten Leben in einer dann gesamtdeutschen Bundesrepublik. |
| |
| Im Rückblick ist es üblich geworden, den ersten der beiden Träume als eine unrealistische Vision abzutun. Und das war dieser Traum gewiss auch. Darüber sollte jedoch nicht vergessen werden, dass für die meisten Menschen in der DDR Veränderungen innerhalb des Sozialismus für lange Zeit die einzige realistische Option zu sein schienen, auch für mich. Dass in der DDR Verhältnisse wie in der Bundesrepublik möglich wären, das glaubte für eine überschaubare geschichtliche Zeit doch auch kaum jemand im Westen. Bisher hatte allerdings die harte Hand der Sowjetunion jeden Versuch gewaltsam verhindert, einen anderen Sozialismus zu schaffen, als ihn Lenin und Stalin in der Sowjetunion etabliert hatten. Daher war ja auch offen geblieben, welchen Weg der Prager Frühling ohne sowjetische Militärintervention genommen hätte. Was wäre denn geschehen, wenn die Tschechoslowakei, wie sich 1968 abzeichnete, ein Mehrparteiensystem ohne Führungsanspruch der kommunistischen Partei, demokratische Wahlen, wirkliche Gewerkschaften und eine rechtsstaatliche Ordnung eingeführt hätte? Welchen Weg wäre unter solchen Umständen die staatliche Zentralplanwirtschaft gegangen und hätte sie den Test demokratischer Mehrheitsentscheidungen überstanden? Das hätte nur die reale Geschichte zeigen können, die gewaltsam abgebrochen wurde. |
| |
| Wer 1989/1990 für einen sozialistischen Neuanfang plädierte, der hatte jedenfalls keine konkreten Argumente in der Hand, sondern konnte nur auf nie realisierte Ideale und Visionen verweisen. Angesichts von vierzig Jahren Erfahrung mit einem diktatorischen Regime und angesichts einer maroden Wirtschaft konnte das die meisten nicht davon überzeugen, sich – nun freiwillig – auf ein neues Gesellschaftsexperiment einzulassen. Welche andere Existenzberechtigung hätte aber die DDR sonst noch haben können? Was aus dem Verfassungsentwurf einer Arbeitsgruppe des Zentralen Runden Tisches sprach, war weithin die Vorstellung, man könne der Bundesrepublik eine basisdemokratische, radikal ökologische und radikal pazifistische Alternative gegenüber und vielleicht sogar entgegen stellen. Ich sah darin vor allem die Illusion, durch prinzipiell auf Konsens hin zielende partizipatorische Entscheidungsstrukturen könne man ein Höchstmaß an individueller Freiheit mit einem Höchstmaß an sozialer Gerechtigkeit harmonisch, verlässlich und dauerhaft miteinander verbinden. Man muss viele geschichtliche Erfahrungen ausblenden, um das für wirklichkeitsgemäß zu halten. Und auch Enttäuschungen über das Leben im vereinigten Deutschland dürften eigentlich nicht den Blick dafür verstellen, dass sich ein solcher Weg als ein gefährliches Abenteuer erweisen hätte. Aber auch wenn dies ein Traum blieb, so ist es gleichwohl ein Ideal, das Menschen bewegen kann und daher wohl auch immer geschichtsmächtig bleibt, und sei es nur als Impulsgeber und als Korrektiv von Fehlentwicklungen gesellschaftlicher Rücksichtslosigkeit. |
| |
| Wie realistisch war nun aber der Traum vom guten Leben in der Bundesrepublik? Jedenfalls war die Faktenlage klar. Die Bundesrepublik war – und ist – eine stabile Demokratie und ein funktionierender Rechtsstaat. Sie konnte auf eine vierzigjährige Erfolgsgeschichte zurückblicken, die sie nicht zuletzt einer leistungsfähigen sozialen Marktwirtschaft verdankte. Sie kannte freilich auch Probleme, Spannungen und Krisen; sie hatte in der zweiten Hälfte ihrer geschichtlichen Existenz auch tiefer gehender Auseinandersetzungen erlebt, wie die Studentenrebellion von 1968 und deren Folgen, die Attentate der RAF, die Konflikte um die Wiederbewaffnung, um die Notstandsgesetze und um den Nato-Doppelbeschluss, den Streit um Kernenergie und Umweltschutz. Für viele in der DDR war dies jedoch von untergeordneter Bedeutung, zumal sich immer wieder gezeigt hatte, dass die Bundesrepublik solche Herausforderungen längerfristig zu bewältigen oder zu überleben schien. Dazu kam der sich immer wieder bestätigende Eindruck, dass die meisten, welche, wie und wann auch immer, „nach dem Westen“ gegangen waren, diesen Schritt nicht bereut, sondern ihre Lebensumstände merkbar verbessert hatten. |
| |
| Wer unsere Ausgangslage im Oktober 1990 und unsere Entwicklung während der letzten zwanzig Jahre mit der unserer mittelosteuropäischen Nachbarn vergleicht, der wird nicht bestreiten können: Diese Fakten und Argumente für die Einheit sind auch heute noch überzeugend, vorausgesetzt, man entscheidet sich grundsätzlich für eine freiheitliche Staats- und Gesellschaftsordnung im westlichen Verständnis. Es gibt, wenn auch mit erheblichen Unterschieden zwischen den mitteleuropäischen Ländern, keinen Punkt, in dem es ihnen besser ginge als uns – weder im Wohlstand und im wirtschaftlichen Erfolg, noch in Bezug auf politische Stabilität und rechtsstaatliche Zuverlässigkeit. Und ganz gewiss nicht bei der Belastbarkeit des sozialen Netzes. Wenn man in diesen Ländern dennoch ein höheres Selbstbewusstsein antrifft, so deshalb, weil für das, was sie tun und sagen, vor allem, wenn nicht ausschließlich, ihr eigener Maßstab gilt. Das ist bei uns zur Bundesrepublik Dazugekommenen und überdies nun schon lange von ihr Alimentierten in der Tat anders. Denn in Deutschland wird bis heute über die Form und über die Folgen der Einheit debattiert. Das ist freilich weniger eine gesamtdeutsche Debatte als eine Ost-West-Debatte, wenn nicht eine Debatte des Westens über den Osten. Denn in dieser Debatte sind wir Ostdeutschen zwar die Betroffenen, aber unser Wort hat erkennbar weniger Gewicht. |
| |
| Am Anfang stand eine kräftige Fehleinschätzung dessen, was das unmittelbare Ergebnis der Einheit sei könne – im Osten wie im Westen Deutschlands. Dieser gemeinsame Irrtum fand seinen einprägsamen Ausdruck im Kohlschen Bild von den blühenden Landschaften. Im Westen hatten viele die Erwartung, es würde sich in Ostdeutschland, befreit von den Zwängen der Planwirtschaft und unterstützt von der Bundesrepublik und von Europa, wie zu Beginn der Geschichte der Bundesrepublik eine Art Wirtschaftswunder ereignen. Und im Osten waren viele schon lange der Auffassung, wenn man sie nur so ließe, wie sie könnten und wollten, und die strangulierende Parteiherrschaft beende, dann käme das Land in kurzer Frist voran. Freilich unterschied sich unsere Situation von der im Westen zu Beginn des Wirtschaftswunders in gravierender Weise. Dann damals lag ganz Europa in Trümmern, und jeder und alles wurde gebraucht. Die DDR-Wirtschaft brauchte jedoch niemand, und die Deutschen in der DDR waren nur als Konsumenten westlicher Produkte interessant. Umgekehrt waren damals nicht wenige von uns als Käufer wiederum nur an westlichen Produkten interessiert. Und gefährdeten damit Arbeitsplätze im Osten. |
| |
| Überdies war die DDR-Wirtschaft zwar nicht kriegszerstört, aber sie lag in ihren Produktionsbedingungen und in ihrer Produktionsleistung international gesehen um Jahrzehnte zurück. Um im eigenen Land wie auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig zu sein, musste sie – wie jeder Neuhinzukommende – nicht nur gleich gut, sondern besser sein oder doch jedenfalls etwas bieten, was es bisher nicht gab. Um eine solche Leistung zu erreichen, bedurfte es einer völlig neuen Industrie – durch Milliarden für Investitionen. Niemand kann bestreiten, dass solche Investitionen in beachtlicher Zahl erfolgt sind. Und es gibt heute in Ostdeutschland hochleistungsfähige Wirtschaftsstandorte, die zwar, wie man in Dresden erleben musste, nicht vor Krisen geschützt sind, aber doch auf dem Weltmarkt auf der Grundlage modernster Standards konkurrieren. Was diese Industrie aber zugleich kennzeichnet, ist, dass sie ihre Leistungen mit sehr viel weniger Arbeitskräften erbringen, als dies für die Situation in der DDR typisch war. Zugespitzt gesagt: Die notwendige Modernisierung unserer Wirtschaft führte unvermeidlich dazu, dass viele Menschen ihren Arbeitsplatz verloren und auch keine Aussicht hatten, in ihrem bisherigen Umfeld in absehbarer Zeit neue Arbeit zu finden. Das hatte zwei gravierende Folgen: Viele Jüngere entschieden sich über kurz oder lang in die alten Bundesländer zu gehen. Dort sind sie durch ihre Ausbildung und durch ihren Arbeitswillen in aller Regel recht erfolgreich. Und sie tragen durch ihre Arbeit zur höheren Lebensqualität der westlichen Bundesländer bei. Viele Ältere, die ihr bisheriges Leben nicht mehr grundlegend ändern konnten oder wollten, resignieren, weil sie keine Perspektive mehr für sich erkennen können. Auch sie profitieren meist dennoch in ihrem Lebensmöglichkeiten von der Einheit. Aber wer will es ihnen ernsthaft verdenken, dass sie ihren Traum vom vereinigten Deutschland nicht vergessen wollen und darum enttäuscht sind? |
| |
| Trotzdem bleibt wahr: Auch wenn der Traum nicht zur Wirklichkeit wurde, so ist doch eine Wirklichkeit entstanden, die Elemente von dem enthält, was Menschen damals erhofften. Man könnte auch sagen: Aus der DDR ist keine blühende Landschaft geworden, aber es gibt im Osten blühende Orte und Landschaften. Dresden ist dafür ein überzeugendes Beispiel. Wer diese Stadt aus der Zeit vor 1990 kennt und sie heute sieht, der muss bekennen: Was Fritz Löffler in seinem berühmten Buch als „Altes Dresden“ heraufbeschwor und was damals unwiederbringlich verloren schien, ist heute im Bild dieser Stadt wieder erkennbar. Die Technische Universität Dresden, die lange nicht – wie ihre gleichaltrigen Schwestern – zu einer umfassenden universitas werden konnte, hat kräftig aufgeholt und auch die Voraussetzungen, längerfristig zur Spitzengruppe aufzuschließen. Und die Medizinische Akademie ist, was sie eigentlich immer wollte, zu deren Medizinischer Fakultät geworden, die sich wachsender nationaler und internationaler Anerkennung erfreut. Was 1990 mit einem herb enttäuschenden Votum des Wissenschaftsrates begann, wurde dann – durch eigenen Leistungswillen und mit einem erprobten Verbündeten aus eben diesem Wissenschaftsrat – zu einer wirklichen Erfolgsgeschichte. Ich weiß nicht, was Kenner der früheren Akademie und ihres Klinikums davon halten, wie Uwe Tellkamp im „Turm“ ihren damaligen Zustand beschreibt, aber als literarisch zugespitzter Kontrast mag es uns an eine Realität erinnern, die vergangen ist und uns heute sehr fern steht. |
| |
| Ein hartnäckiger Begleiter unseres Aufbaus bleibt freilich die Sorge, noch nicht auf eigenen Füßen zu stehen, immer noch zu den Ärmeren in Deutschland zu gehören und uns um Kunst und Wissenschaft ängstigen zu müssen. In den ersten Jahren hofften wir noch, diesen Abstand rasch aufholen zu können. Aber ab 1996/1997 ging die Schere zwischen Ost und West in Deutschland wieder auseinander und wir mussten erkennen, dass wir sehr viel mehr Zeit brauchen würden, als nicht wenige 1990 meinten. Damals war von fünf Jahren die Rede. Bald werden es zwanzig Jahre sein, und das Ziel ist noch nicht in Sicht. Allerdings wurden 1996/97 auch die Auswirkungen der Globalisierung für ganz Deutschland deutlich. Und die Auffassung setzte sich durch, die Bundesrepublik müsse durch Verzicht auf das, was sie für viele in West und Ost so attraktiv gemacht hatte, nämlich auf sozialstaatliche Errungenschaften, fit gemacht werden für den globalen Wettbewerb, in dem nur noch der kurzfristig zu erreichende Höchstgewinn zählt. Die dadurch herbeigeführte Finanzkrise lässt nicht nur uns im Osten Deutschlands auf die auf 1997 folgenden zehn Jahre kritisch zurückblicken. In jedem Fall müssen wir immer noch den Rückstand aufholen, den uns die deutsche und europäische Teilung und die sozialistische Planwirtschaft eingebrockt haben. Die Einsicht ist richtig, aber sie kränkt und verletzt. |
| |
| Nach jeder Revolution führt der Weg vom Traum zur Wirklichkeit über das eigene Tun oder Lassen, über die eigenen Erfolge und Niederlagen, kurz gesagt, über die eigene Erfahrung. Für uns kommt dazu ein spezifisch ostdeutscher Aspekt des revolutionären Wandels im östlichen Teil Europas. Zwar zeigt uns die Geschichte ganz generell, dass das, was eine Revolution bringt, meist anders ist, als was man sich von der Revolution erhoffte. Im Normalfall ergibt sich diese Differenz aber aus der Summe des eigenen Lernweges. Es sind die eigenen Entscheidungen, es sind die eigenen Erfahrungen, und es sind nicht zuletzt die eigenen Fehler, über die man sich streitet. Die Deutschen in der DDR wurden aber über Nacht zu einer Minderheit in einer fertigen und – jedenfalls ihnen gegenüber – überaus selbstbewussten und darum nicht selten auch anmaßenden Bundesrepublik. Das hatte den Vorteil einer erprobten und bewährten Ordnung. Denn was eine bürgerliche Gesellschaft und einen demokratischen Rechtsstaat ausmacht, das hatten wir im Osten nicht selbst erfahren können. Nun mussten wir deren Normen und Prozesse nicht neu erfinden. Es hatte für uns jedoch den Nachteil, von einem Tag zum anderen zum Lehrling zu werden, wenn nicht sogar zum Einwanderer im eigenen Land. Denn viele hatten zwar mit Neid und Bewunderung auf die Bundesrepublik geblickt. Und wer es konnte, der war, nach einem Wort Erhard Epplers, so oft wie möglich abends um 20.00 mit Hilfe des Fernsehers auch dahin ausgewandert - allerdings als ein Zuschauer, der nicht betroffen ist, sich darum auch nicht engagiert und nur selten mit dem Gesehenen kritisch auseinandersetzt und der überdies oft mehr nach Unterhaltungswert denn nach Teilnahmeinteresse auswählt. Zugespitzt gesagt: Nicht wenige Deutsche in der DDR hatten keine konkreten Vorstellungen, auf was sie sich mit dem Beitritt einließen. Und manche haben das größere Deutschland bis heute nicht verstanden. |
| |
| Nach dem Beschluss der Volkskammer vom 23. August 2009 traten wir nicht der Bundesrepublik, sondern der Ordnung des Grundgesetzes bei. Aber das Grundgesetz war vor mehr als vierzig Jahren ausgearbeitet und beschlossen worden. Inzwischen hatte sich die auf dieser Basis gegründete Bundesrepublik zu einem höchst komplexen Gebilde entwickelt. Vor allem war eine in sich widersprüchliche und sich an westlichen Leitbildern orientierende Gesellschaft entstanden. Vierzig Jahre getrennter Entwicklung waren ein Faktum, das ernst genommen werden musste. |
| |
| Wir wollten durch die Einheit wieder ein Teil Deutschlands werden. Aber maßgebliche Kreise der bundesdeutschen Gesellschaft gingen schon seit zwei Jahrzehnten zu möglichst allem, was mit Deutschland zusammenhängt, auf demonstrative Distanz. Der Abschied von der deutschen Sprache, den wir heute allenthalben erleben, ist ja nur das letzte, allerdings besonders schockierende Ergebnis dieser Haltung. Und neben der Wirtschaft ist es hier insbesondere die Wissenschaft, welche zielstrebig auf einen neuen Traum hinarbeitet: Nämlich auf eine globale Gesellschaft, die englisch spricht und amerikanisch denkt. Aus diesem Traum kann es für einen Deutschen, der sein Land und dessen Kultur und der seine Sprache liebt, nur ein böses Erwachen geben. |
| |
| Ein anderes Ergebnis der bundesdeutschen Entwicklung ist der hohe Grad von Verrechtlichung, die als individuelle Freiheitssicherung verstanden wird. Die unvermeidliche Folge ist eine ausgebaute Bürokratie. Wir hatten die Bürokratie in der DDR erlebt und gemeint, schlimmer könne es eigentlich nicht kommen, da wurden wir bald eines Anderen belehrt. Kurioserweise hängt die Rolle der Bürokratie in beiden Fällen mit dem in Staat und Gesellschaft vorherrschenden Selbstverständnis zusammen. Die DDR war eine Planungs- und Erziehungsdiktatur, welche die Gesellschaft weithin verstaatlicht hatte. Denn der Staat war ja, wie ganz offen gesagt wurde, das wichtigste Instrument der angeblich herrschenden Arbeiterklasse, tatsächlich aber der Führung einer Partei, die sich als Arbeiterpartei bezeichnete. Die DDR-Bürokratie ergab sich also aus dem Willen zur zentralen Planung und Leitung möglichst aller Lebensprozesse und war damit zwangsläufig mit Willkür und Rechtlosigkeit verbunden. |
| |
| Umgekehrt soll die bundesdeutsche Bürokratie ein Höchstmaß an individueller Freiheit und nachprüfbarer Gleichbehandlung garantieren. Denn in der Bundesrepublik hat man die Grundrechte, die eigentlich als Elemente der freiheitlichen und demokratischen Ordnung formuliert worden waren, längst zu Abwehrrechten gegen die Staat, wohlgemerkt,gegen den Staat eben dieser freiheitlichen Demokratie umgedeutet. Die Individualrechte hält man jetzt für den einzigen Inhalt von Freiheit. Unvermeidlich ist dies mit einer Abwertung des Gemeinwohls und des Allgemeininteresses verbunden, die als nicht greifbar, wenn nicht sogar als freiheitsgefährdend verdächtigt wurden. Allerdings wollte man sich nun auch nicht auf die Risiken eines rein individualistisch gedeuteten Freiheitsbegriffs einlassen, so dass es zu einem gesellschaftlich sehr einflussreichen Ziel wurde, möglichst alle Lebenschancen rechtlich einklagbar zu machen und alle Lebensrisiken rechtlich auszuschließen. Dem entsprach die Tendenz, den Entscheidungsraum der demokratischen Politik immer weiter einzuschränken und sie der Detailkontrolle durch Verfassungs- und Verwaltungsrichter zu unterwerfen. Der Vorwurf, dass etwa verfassungswidrig sei, gehört heute zu den häufigsten und vor allem zu den wirkungsvollen Argumenten. Dass dies zu einem Übermaß von Verrechtlichung der Bundesrepublik geführt hat, ist eigentlich nur konsequent. Und aus Verrechtlichung folgt nun einmal Bürokratie im eigentlichen Sinne des Wortes. |
| |
| Dennoch besteht zwischen der Bürokratie in der DDR und der in der Bundesrepublik ein fundamentaler Unterschied. Denn in einer freiheitlichen Ordnung kann über den Sinn und über die konkrete Ausgestaltung der Freiheit immer weiter debattiert werden kann. Das ist zwar mühselig und gelegentlich auch frustrierend, aber dennoch eine reale Chance zur Veränderung. Dagegen bot der unbegrenzte Führungsanspruch der SED-Diktatur eine solche Chance nicht. Daran ist sie dann auch zu Grunde gegangen. |
| |
| Was viele Deutsche aus der DDR beim näheren Kennenlernen der Bundesrepublik nicht minder verblüffte als das Ausmaß der Bürokratie, das war das unfassbare Maß an Ideologisierung der öffentlichen Meinung. Was die Herrschaft einer Ideologie ist, das hatten wir gründlich erfahren. Eine Ideologie ist eine systematisierte Begriffswelt, welche die Wirklichkeit nicht nur einordnet und beurteilt, sondern die auch vorgibt, was von dieser Wirklichkeit wahrgenommen werden darf und was nicht. Ideologie und Realitätsverweigerung gehören zusammen, insbesondere, wenn die Ideologie über staatliche Macht verfügt. Man hätte meinen sollen, dass in einer freiheitlichen Gesellschaft der permanente öffentliche Diskurs dafür sorgt, dass Strategien der Realitätsverweigerung nur eine geringe Chance haben. In keinem Punkte habe ich mich so geirrt wie in diesem. Denn in der Bundesrepublik ist so gut wie jedes Themenfeld der öffentlichen Debatte und Entscheidungsfindung ein Tummelplatz ideologischer Schlachten, die viel zu selten aus dem Stellungskrieg in eine verheißungsvolle Bewegung der feindlichen Fronten auf eine gemeinsame realistische Position hin umschlagen. Sehr viel häufiger hört man das Gemisch von hysterischer Empörung und klammheimlicher Schadenfreude, wenn einmal wieder jemand auf die Mine eines ideologischen Tabubruchs getreten ist. |
| |
| Man denke nur an die familienpolitischen Auseinandersetzungen, bei denen die eine Seite die Familie aus ihrer zentralen Rolle in der Gesellschaft herausdrängen und die andere Seite sie auf ein Modell der angeblich naturgegebenen Rollenunterscheidung zwischen Mann und Frau festlegen will. Die Zukunft der Gesellschaft gerät dabei völlig aus dem Blick, wie die demographische Entwicklung unseres Volkes zeigt. Die eigentlich ganz einfache Wahrheit, dass nur der Zusammenhang der Generationen in der Familie Zukunft garantiert, dass aber diese Familie nur lebbar bleibt, wenn die Gleichberechtigung der Frau auch in der Berufswelt gilt und darum die Kindererziehung öffentlich unterstützt werden und sich ein neues Vaterbild durchsetzen muss – diese Erkenntnis gewinnt erst ganz allmählich in der bundesdeutschen Gesellschaft an Boden. Ich bin weiß Gott nicht von DDR-Nostalgie bestimmt. Natürlich weiß ich, dass die Familienpolitik und die Bildungspolitik der SED ideologiebestimmt waren, denn sie sollten einen „neuen Menschen“ schaffen. Teils im Widerspruch dazu, teils aber auch dadurch befördert entstand in der DDR gleichwohl ein modernes Frauen- und Familienbild – so wie im westlichen und nördlichen Europa. Verglichen damit war die alte Bundesrepublik familienpolitisch ein Entwicklungsland. |
| |
| Ich sprach von der demographischen Situation und von meiner Sorge, dass diese die Zukunft unseres Volkes bedroht. So etwas zu sagen, ist für viele in Deutschland politisch nicht korrekt. Denn auch „Volk“ ist ein Begriff, der „im Westen“ geschichtlich als schwer belastet gilt und deshalb unter ideologischem Verdacht steht. Dem entspricht, dass Demokratie kaum noch als gemeinsame Entscheidung und gemeinsame Verantwortung verstanden wird, sondern vor allem als individuelle Chance zur Partizipation und zur Interessenvertretung. Das bleibt natürlich nicht ohne Folgen für das Maß gemeinsamer Verantwortung und für die Rücksicht auf das Gemeinwohl. Man denke an die fortschreitende Verwahrlosung des öffentlichen Raums und den Verfall eines kulturvollen Umgangs miteinander. Auch dieses Thema ist ideologisch besetzt. Denn solche Erscheinungen gelten in tonangebenden Kreisen als liberal und weltoffen und haben daher Anspruch auf Toleranz. Ich halte solche Art von Toleranz für falschen und feigen Konformismus, der die geistigen Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens ruiniert und letztlich zerstört. |
| |
| Noch manches andere Kritikwürdige wäre zu nennen. Es liefe alles auf die Einsicht hinaus: Nein. Die Erfüllung eines Traums ist die Bundesrepublik wahrlich nicht. Aber das hat sie auch nie von sich behauptet. Was sie dagegen mit Recht für sich in Anspruch nehmen kann, das ist: Sie ist ein Ort real existierender Freiheit. Denn sie bietet die realistische Chance zur Debatte und damit zum Wandel. Freilich ist dies nur durch Einsatz und Streit zu haben. Und hier muss die Selbstkritik der Ostdeutschen ansetzen. Aus dem Westen ist ja oft die Behauptung zu hören: Wir schätzten die Gerechtigkeit mehr als die Freiheit. Das halte ich für großen Unsinn. Denn erstens ist Freiheit ohne Gerechtigkeit ganz rasch nur noch die Freiheit der Reichen und Mächtigen. Und zweitens befinden sich jene, welche uns so kritisieren, selbst in aller Regel in einem solchen Status und in einer solchen finanziellen Situation, dass sie nicht nach Gerechtigkeit rufen müssen. Freiheit ist für die meisten Menschen auf Dauer nur als gemeinsame Freiheit zu haben. Und diese gemeinsame Freiheit kann nur in und mit einem Staat der freiheitlichen Demokratie Wirklichkeit werden. |
| |
| Was man vielen in Ostdeutschland dagegen mit Recht vorwerfen kann, ist ein erfolgs- und harmoniegetränktes Verständnis von Freiheit. Freiheit bietet aber immer nur die Chance zum Erfolg. Und die Freiheit der Meinung erweist sich im öffentlichen Leben meist im Streit. Wie sollte sich die Gesellschaft auch sonst bewegen können? Es sei denn, man vertraut darauf, dass der Wettbewerb dies hinter unserem Rücken zur allgemeinen Zufriedenheit regelt. Diese Erwartung hat uns aber gerade gründlich getäuscht. Um so dringender ist die öffentliche Debatte, und zwar in erster Linie darüber, was für die ganze Gesellschaft und für ihre Zukunft gut ist. An dieser Debatte sollten sich die Ostdeutschen sehr viel stärker und sehr viel selbstbewusster beteiligen. Dazu gehört allerdings auch zu begreifen, dass das Recht zum freien Wort für alle gilt. Wer auf Widerspruch mit beleidigtem Schweigen reagiert, darf sich nicht über einen Mangel an Freiheit beklagen. Freiheit verwirklicht sich eben im Streit. Aber eben im Streit darum, was die Verantwortung für uns selbst und für dieses Land von uns verlangt und nicht im Gemaule aus irgendwelchen Ecken, wobei man sich meist nur in Einem einig ist: Sich einer sachorientierten und argumentierenden Auseinandersetzung zu entziehen und stattdessen pauschal auf die Politik und die Politiker zu schimpfen. Ein solches Verständnis von Demokratie führt in die Irre und entlarvt die sich wachsender Beliebtheit erfreuende Wahlenthaltung als eine Art von politischer Selbstbefriedigung. |
| |
| Ich bekenne mich zur Bundesrepublik als einem Ort der real existierenden Freiheit und der Chance zu einem Weg in die Zukunft. Und ich bekenne mich trotz aller Kritik und auch so mancher Enttäuschung zur Bundesrepublik als dem besten Staat, den wir Deutschen je hatten. Man mag dies eine spröde Liebeserklärung nennen. Belastbar und zuverlässig ist sie gerade deshalb. |
|
Prof. Dr. Dr. h.c. Hans Joachim Meyer
Sächsischer Staatsminister a.D. |